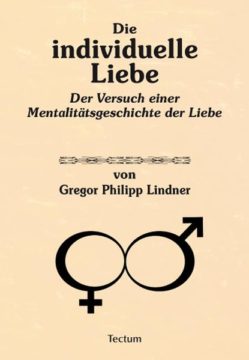Schon ein kurzer Blick in die Vorabendprogramme sämtlicher großer Fernsehanstalten zeigt: Liebe hat nach wie vor Hochkonjunktur. Der Rückgang der Eheschließungen und hohe Scheidungsquoten sprechen dagegen eine andere Sprache. Dauerhafte Liebesbindungen werden in der Realität immer seltener. Stattdessen lebt und fühlt man Liebe durch TV-Konsum. Der Autor zeigt in seiner historisch angelegten Studie auf, wie es dazu gekommen ist: In der vormodernen Gesellschaft stand die individuelle Liebe im Schatten drängender existenzieller Bedürfnisse. Das Überleben der Familie musste gesichert werden. Im Zuge der industriellen Revolution gewann der Einzelne jedoch an persönlichem Handlungsspielraum. Zunehmend freier von gesellschaftlichen Konventionen und religiösen Bindungen konnte er sein Verhältnis zu anderen nach persönlichen Bedürfnissen gestalten. Doch profitiert die individuelle Liebe als ein intimes und vertrauensvolles Miteinander der Geschlechter davon? Der Autor zweifelt daran. Die durch den Wandel der Industriegesellschaft gewonnene freie Zeit kommt der Liebe selten zugute. Sie wird nämlich nicht dazu genutzt, sich die dauerhafte Zuneigung eines anderen durch Geduld, Zuhören und eigenes Engagement zu erarbeiten. Zu hohe Erwartungen an den jeweils anderen, neue Formen des gesellschaftlichen Leistungsdruckes und mangelndes Verständnis für die Andersartigkeit des anderen Geschlechtes geben der individuellen Liebe erneut wenig Raum. Allerdings gilt auch bei dem Thema Liebe: Man muss wagen und wollen, um zum Ziel zu gelangen. (Prof. Dr. Peter-Michael Hahn)
- Veröffentlicht am Montag 21. Juni 2010 von Tectum
- ISBN: 9783828823495
- 121 Seiten
- Genre: Geschichte, Sachbücher