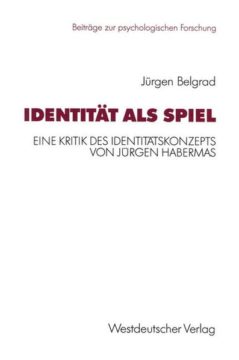1. Zu den Bedeutungsebenen von »Identität«.- 1.1. Logische Identität.- 1.2. Epistemische Identität.- 1.3. Persönliche Identität.- 2. Kritikmaßstäbe und das exemplarische Modell von HABERMAS.- 3. Zur Gliederung der Arbeit.- 1: Das Modell der ICH-Identität von Jürgen Habermas.- I. Der Begriff der Ich-Identität.- 1. Deskriptiver Identitätsbegriff: Ich als Interaktionskompetenz.- 2. Normativer Identitätsbegriff: Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung.- 2.1. Sittliches Verhältnis und Konstitution von Subjektivität.- 2.2. Zerstörte Sittlichkeit als entzweites Verhältnis.- 2.3. Die kommunikationstheoretische »Sittlichkeit«: Versöhnung, Vernunft und Freiheit als Verständigung, kommunikative Rationalität und Ich-Identität.- 2.3.1. Versöhnung als Verständigung.- 2.3.2. Vernunft als kommunikative Rationalität.- 2.3.3. Freiheit als Ich-Identität.- 2.4. Ich-Identität als Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung.- II. Kompetenzen der Ich-Identität.- 1. Kontinuitätsbildung in der Lebensgeschichte.- 2. Gestufte Identitätsbildung und flexible Prinzipienorientierung.- 2.1. Stufen der Identitätsbildung.- 2.1.1. Stufe »natürliche Identität«.- 2.1.2. Stufe »Rollenidentität«.- 2.1.3. Stufe »Ich-Identität«.- 2.3. »Kommunikative Verflüssigung« moralischen Bewußtseins und innerer Natur.- 3. Wahrung der zeitlichen und räumlichen Konsistenz (personale und soziale Identität).- 3.1. Konsistenz /Einheit.- 3.2. Personale Identität.- 3.3. Soziale Identität.- 4. Situations- und Krisenbewältigung (Balance von personaler und sozialer Identität).- 4.1. Integrierender Aufbau neuer Identitäten durch Umorientierung.- 4.2. Balance von personaler und sozialer Identität.- 5. Unverwechselbare Lebensgeschichte durch Selbstidentifikation.- 5.1. Abgrenzung der Subjektivität und intersubjektive Anerkennung der Selbstidentifikation.- 5.2. Formen und Stufen der Selbstidentifikation.- 5.2.1. Formen der Selbstidentifikation.- 5.2.2. Stufen der Selbstidentifikation.- 5.3. Selbstidentifikation als indirekte Selbstrepräsentation.- 2: Kritik der ICH-Identität.- III. Das Verhältnis von Identität und Nichtidentität.- 1. Der herrschende Zwang von Identität.- 2. Der notwendige Zwang von Identität.- 3. Der Zwang einer ‘verwilderten’ Identität.- 3.1. Die verwinkelte Dialektik von Identität und Nichtidentität.- 3.2. Die zum Primat erhobene Identität.- 4. Die Rettung des Nichtidentischen durch dessen Evozierung.- IV. Kritik der Kompetenzen von Ich-Identität.- 1. Einebnung der Erlebnisse durch Kontinuität:Das Subjekt als Differenz.- 1.1. Kontinuität, Subjektgeschichte und Differenz.- 1.2. Kontinuität und Diskontinuität.- 1.3. Kontinuitätsbildung als Krisenstrategie.- 2. Prinzipienorientierung: Ausblendung von Sinnlichkeit und halbierte Rationalität.- 2.1. Prinzipienorientierung und universalistische Moral.- 2.2. Indirekte Ausblendung von Körper und Sinnlichkeit.- 2.3. Übergeordnete Orientierung an Rationalität.- 3. Konsistenz als Zwangsstruktur – dis Subjekt als »Vielheit«.- 3.1. Kritik der »Einheit«.- 3.1.1. Zwangsstruktur und Selbst-Herrschaft.- 3.1.2. Problematik der Einheitsbildung.- 3.1.3. Gesellschaftlich induzierte Fragmentierung.- 3.1.4. Das Subjekt als »Vielheit«.- 3.1.5. Zur Dialektik von Einheit und Vielheit.- 3.2. Verdünnte Versöhnung und Fixierung der Entzweiung.- 4. Balancierende Krisenbewältigung: Anpassung statt entäußerter Subjektivität.- 4.1. Die Begrenztheit von »Einzigartigkeit« und »Gleichheit«.- 4.2. Anpassung, Warencharakter und Selbsterhaltung.- 5. Selbstidentifikation als bloße Selbst-Erhaltung.- 5.1. Selbstidentifikation als buchhalterische Selbstverwaltung.- 5.2. Erweiterung der »indirekten Selbstrepräsentation«.- 5.3. Mimesis als Herstellung von Subjektivität im Verhältnis.- V. »Zwanglose Identität« als spielerische Subjektentfaltung.- 1. Spielerische Subjektentfaltung als ästhetische Inszenierung der Lebenswelt.- 2. Poiesis als spielerisch-ästhetische Selbsterzeugung im mimetischen Verhältnis.- 3. Die Schein-Welt des Spiels als Vor-Spiel von Lebensentwürfen.- 4. Poetische Vernunft: Sinnlichkeit und Rationalität im Spiel.- 5. Spiel und Nichtidentität.- VI. »Interaktionsspuren« als »Interaktionsformen«.- 1. Die »unbewußten Interaktionsformen« (»Trieb«).- 2. Die »sinnlich-symbolischen Interaktionsformen«.- 3. Die »sprachsymbolischen Interaktionsformen«.- 4. Beschädigte Interaktionsformen.- 4.1. Deformierung der unbewußten Interaktionsformen.- 4.2. Deformierung der sinnlich-symbolischen Interaktionsformen.- 4.3. Deformierung der sprachsymbolischen Interaktionsformen.- 5. Interaktionsformen und zwanglos-spielerische Subjektivitätsbildung.- VII. Lebensgeschichte als spielerische Selbstinszenierung: Selbstverstehen und Selbstgestalten.- 1. Sich-Verstehen als szenisches Verstehen.- 2. Ein alltagspraktisches Sich-Selber-Verstehen.- 2.1. Dialektik in der Aufklärung der Lebensgeschichte.- 2.2. Grundlagen des alltagspraktischen Sich-Selber-Verstehens.- 2.3. Inszenierung einer dramatisierten Erzählung.- 3. Ein annäherndes Resümee: Das Subjekt als Symbol im poetischen Selbstentwurf.- Personenregister.
- Veröffentlicht am Mittwoch 1. Januar 1992 von VS Verlag für Sozialwissenschaften
- ISBN: 9783531123295
- 300 Seiten
- Genre: 20., 21. Jahrhundert, Hardcover, Philosophie, Softcover