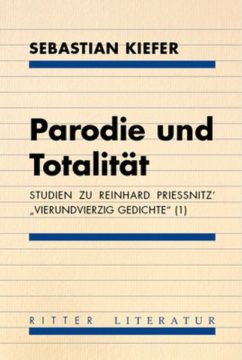Reinhard Priessnitz war gerade einmal Anfang 30, als 1978 die vierundvierzig gedichte erschienen, jenes schmalste und rätselhafteste Jahrhundertbuch der deutschen Dichtung. Der Ruf dieser Lyrik ist legendär, ihr Anspruch von anstoßerregender Größe: Herauszufinden, was ein poetischer Text heute sein kann, erforderte für Priessnitz nämlich nicht weniger, als alle Sprechweisen, Dichtideale, Text- und Sprachbegriffe von Einst und Jetzt, aus den Höhen und Tiefen des Redens, von der Gosse über die Zwecksprachen des Alltags bis zum erhabenen Gesang und der methodischen Materialarbeit mit ins Kalkül zu ziehen. Nur wer das Ganze kennt, kann wissen, wonach man überhaupt fragt und sucht, wenn man heute „Gedicht“ sagt.
Jedes der 44 Gedichte entwickelt Wege, unvereinbar entfernt scheinende dichterischer Sprech- und Gestaltungsweisen und ästhetische Ideale sich gegenseitig durchdringen, verzehren, überblenden, befehden zu lassen. Dass Texte von solcher Kühnheit und Komplexität wie spielerisch gemeisterte Fingerübungen daherkommen, dass das Vertrackteste im Gewand des Blödelns, moderne Erkenntniskritik in Gestalt eines virtuos gemeisterten klassischen Verses erscheinen können, ist ebenso sinnbetörend wie magisch. Die vorliegenden Priessnitz-Studien von Sebastian Kiefer vollziehen – in präziser Begrifflichkeit und fulminanter Argumentation – paradigmatisch die Auseinandersetzung mit beidem: den Rätseln wie der mit ihnen verquickten ästhetischen Lust.
- Veröffentlicht am Samstag 1. Juli 2017 von Ritter Klagenfurt
- ISBN: 9783854155195
- 400 Seiten
- Genre: Belletristik, Essays, Feuilleton, Interviews, Literaturkritik