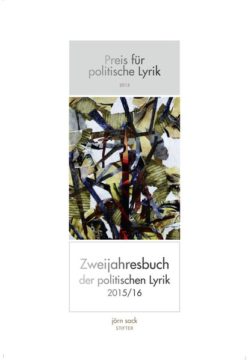Wann, wenn nicht in dieser bewegten Zeit, sollte politische Lyrik, soweit sie überhaupt noch einen Sinn erfüllt, ihre Wiedergeburt feiern?
Sie hatte in Deutschland seit Walther von der Vogelweide bis hin zu Brecht und Biermann eine lange, stolze Tradition und belegte, dass Minnesang, Weltschmerz, Innerlichkeit und Biedermeier selbst zur Zeit ihrer jeweiligen Hochblüte geistig nicht allein den Ton angaben. In den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts jedoch erstarb die politische Lyrik im Westen; nur in der DDR gab es ein leises Fortwirken.
Ich mache mir nichts vor: Die Polly-Wettbewerbe zeigen zwar ein Bedürfnis und Interesse an politischer Dichtung, denn es gab wiederum die hohe Zahl von 648 Einsendungen mit erstmals mehr weiblichen als männlichen Teilnehmern; doch sie haben aus künstlerischer Sicht das Genre noch nicht wiederbelebt und sicher kaum Breitenwirkung erzielt. Dazu fehlt es bisher einfach an Herausragendem – und sei es nur in Form eines einzigen, ganz starken Gedichts. Auch sonst hat sich, abgesehen von Günter Grass‘ letztem (und meiner Ansicht nach aus durchsichtigen Gründen viel geschmähtem) Bemühen (‚Was gesagt werden muss‘) wenig getan. Eine noch so großartige Tradition kann allein nicht das Fortleben einer Kunstgattung sichern, mag sie auch aus unserer Geschichte eine ständige Aufforderung an uns richten. Vielleicht gibt es zwischen der Großen Prosa und dem Theater, die Lebensfragen, einschließlich der gesellschaftlichen, breit und grundlegend angehen, und dem an der Tagespolitik ausgerichteten Kabarett für die politische Lyrik tatsächlich keinen gesicherten Lebensraum mehr. Man wird gegebenenfalls konstatieren müssen, dass für die reine Dichtung, will sie erfolgreich sein, wie etwa die kürzlich ausgezeichneten Monika Rinck und Jan Wagner belegen, nur das Idyll, Selbstversunkenheit oder Blindflug mit Sprachakrobatik und Finassieren bleiben; dass das Wagnis, dem sich politische Lyrik aussetzt, die Wirklichkeit des Lebens – und zwar des gesellschaftlichen – zu packen, notwendig ihre Qualität mindert, wie es die Kunstkritik dem genannten Gedicht des alten Grass bescheinigt hat. Schon Goethe bemerkte ja zu Eckermann: Der Politiker in Uhland werde den Dichter rasch verkümmern lassen. Seltsam nur, dass dies für das lyrischste Theater, die Oper, nicht gilt. Sie zieht bis heute ihre Stoffe vielfach aus gesellschaftlichen, oft sehr aktuellen Konflikten. Ein Symposium über ‚Oper und Politik‘ der Deutschen Oper Berlin hat es im letzten November deutlich gemacht.
Vielleicht schlägt sich die Einsamkeit des literarisch-lyrischen Schaffens unabdinglich im Stoff nieder. Doch warum war es früher anders? Wirkte damals Lyrik auf ein breiteres Publikum und war schon von daher als gesellschaftspolitisches Medium interessant? Die Frage bleibt gestellt.
Die meisten Einsendungen beschäftigten sich, wie könnte es anders sein, mit den Flüchtlingsströmen und Flüchtlingstragödien der letzten Jahre. Leider blieb die künstlerische Bewältigung fast durchweg unzureichend, und keines der vielen hundert Werke zu diesem Thema kam deshalb in die engere Auswahl. Nur in der Anlage finden sich zwei Einsendungen dazu, eine davon ein Prosatext. Die Erkenntnis ist bedauerlich und stellt im Grunde einen Mangel des vorliegenden Bandes dar. Aber Engagement und Herzblut allein bringen nun einmal noch kein gutes Gedicht hervor.
Ich will deshalb einmal sehr konkret, ja aufdringlich didaktisch werden und am Beispiel eines der berühmtesten Werke deutscher politischer Lyrik, Heines ‚Weberlied‘, das Ungenügen vieler Einsendungen illustrieren. Das Original beginnt so:
Im düstern Auge keine Träne,
Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne:
Deutschland, wir weben dein Leichentuch,
wir weben hinein den dreifachen Fluch –
Wir weben, wir weben.
Den Auftakt zu Heines Gedicht bildet ein starkes, sehr konkretes Bild, das aber schon in der dritten Zeile unvermittelt und heftig ins allgemein Politische übergeht. Das Elend der schlesischen Weber ist für Heine Symptom des erbärmlichen Zustands einer ganzen Gesellschaft. Folglich macht das Gedicht in den folgenden Strophen Gott, König und Vaterland als Werte dieser Gesellschaft nieder.
Man könnte das Thema auch anders angehen und es damit vom Ansatz her wirkungslos machen, wie meine bewusst unbeholfene Nachdichtung aufzeigt:
Die schlesischen Weber sind elend dran,
Sie nagen am Hungertuch.
Der Webstuhl ernährt nicht mehr seinen Mann,
drum stößt er aus einen dreifachen Fluch
und webt und webt und webt.
Ich möchte es zur gedanklichen Anregung für die weitere lyrische Arbeit jedem selbst überlassen, die beiden sehr ungleichwertigen Texte im Einzelnen zu vergleichen und vielleicht eine eigene, möglichst bessere Nachdichtung zu versuchen. Keine einfache Sache, aber nützlich für die weitere Arbeit an aktuellen Stoffen.
Interessant ist, dass politische Lyrik dieser Tage die Auferstehung einer Kategorie von Dichtung erzwingt, die nach Brecht fast völlig verloren ging: der Ballade. Viele Einsendungen haben diese einmal hoch im Ansehen stehende Form gewählt. Die besondere Schwierigkeit dabei ist, mit der die Ballade, ein episches Gedicht, auszeichnenden Inbrunst zurechtzukommen, obwohl sie unserer Zeit so gar nicht schmeckt. Die parodistische Verfremdung, die Brecht dafür eingesetzt hat, ist nicht jedermanns Sache und eignet sich auch nicht für alle Gegenstände. Wie auch immer, jedenfalls ist die Wiederbelebung der Ballade im Rahmen politischer Lyrik eine faszinierende Aufgabe, mögliches Scheitern eingeschlossen. Man kann es verkürzt so sagen: Ohne eine neue Kunst der Ballade wird es keine erfolgreiche neue politische Lyrik geben.
Was will, was soll politische Lyrik? Sie ist Kunst, die sich nicht selbst genug ist, aber im Gegensatz zum Essay eindeutig an die Emotion appelliert. Sie soll deshalb klassischerweise begeistern, preisen, anklagen, bloßstellen, verhöhnen, betrauern; heute zunehmend: erfassen, durchschauen, brandmarken, zubeißen, manchmal bloß reflektieren. Aber beim Letzteren wird es schwierig, weil die Emotion verloren geht. Ist politische Lyrik gelungen, lädt sie zu musikalischer Untermalung fast von selbst ein. Die Ingredienzen, deren es dazu bedarf, hat Brecht mit ganz anderer Zielrichtung in der ersten Strophe seines heute als ‚Kinderhymne‘ bekannten Textes, der den Versuch zu einer Nationalhymne neuen Stils darstellte, vorgegeben:
Anmut sparet nicht noch Mühe / Leidenschaft nicht noch Verstand
Betrachtet man von daher die Einsendungen, so fehlt es den wenigsten an Leidenschaft; viele zeichnet auch Verstand aus. Aber mit der Mühe (die man in einem Gedicht nie spüren, aber doch erkennen muss) und vor allem der Anmut hapert es oft.
Wie in bisher allen Wettbewerben zeigte sich auch dieses Mal, dass den Autoren die Utopie gänzlich und selbst die Zuversicht weitgehend abhandengekommen sind, obwohl sie gerade für die Bewältigung der Flüchtlingskrise dringend gebraucht würden. Manchmal möchte man fast meinen, wir lebten trotz des materiellen Erfolgs unserer Gesellschaftsordnung in der schlechtesten aller Welten und Zeiten. Es herrscht Untergangsstimmung.
Dabei durchzieht nahezu alle Werke eine große Sehnsucht nach Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Universalität und Geborgenheit. Allerdings wird meist übersehen, dass zwischen den letzten beiden eine ähnlich schwer abzugleichende Spannung besteht wie zwischen Freiheit und Gleichheit. Diese Spannung, die vielleicht Unverträglichkeit bedeutet, ist praktisch nie herausgearbeitet worden. Dabei ist es ein schönes Thema. Gibt es zwischen Kosmopolitismus und Kiez (notwendige) Verbindungsstücke? Für die meisten Völker der Welt ist das wohl keine Frage. Uns Deutschen aber sind Familie, Religion und Nation, abgestandene, verranzte Begriffe. Stehen wir damit für die Avantgarde gesellschaftlicher Entwicklung oder eher zunehmend wurzellos und somit hilflos da in einer vom technischen Fortschritt getriebenen Zeit?
Jörn Sack
- Veröffentlicht am Mittwoch 27. Januar 2016 von edition bodoni
- ISBN: 9783940781697
- 114 Seiten
- Genre: Belletristik, Lyrik