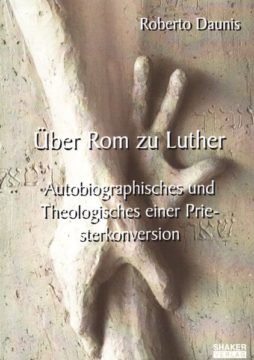Der Autor geht der Frage nach, warum er, ein junger Priester und Doktorand in Rom, 1962 die römisch-katholische Kirche verlassen hat und als Seelsorger und theologischer Lehrer eine neue Heimat in der evangelischen Kirche fand. Die autobiographische Erzählung, anschaulich, subtil und humorvoll geschrieben, vernetzt er mit theologischer Reflexion. Sein Lebensweg beginnt im Großraum Buenos Aires, Mitte der dreißiger Jahre, und führt den Leser in jene Welt der aufstrebenden Einwanderer, aber auch der sozialen Gegensätze. Die Schilderung des religiösen Umfelds öffnet den Zugang zur inneren Entwicklung des Vierzehnjährigen, der ins Seminar geht, um sich das Seelenheil für die Ewigkeit zu sichern und anderen zu helfen, der ewigen Verdammnis zu entkommen. Gottes Beistand vorausgesetzt, strebt der fleißige und angepasste Seminarist eine heilige Vollkommenheit an, die nur durch Frömmigkeit, Gehorsam, Verzicht und Selbstaufopferung zu erreichen ist. Er glaubt der Kirche nahezu alles und hält sich tapfer und redlich an die Regeln, die er mit dem Willen Gottes gleichsetzt. Aber nach der Priesterweihe erfährt er von einem Vorfall, der zum ernüchternden Erwachen und zum Bruch des Vertrauens gegenüber seinen Bischöfen führt. Es war sein Fehler gewesen, alle Bräuche, Regeln und Lehren jener großen Kirche kritiklos hinzunehmen, als sei sie tatsächlich eine nicht hinterfragbare göttliche Größe. Dennoch hofft er, in Rom Antwort auf seine bohrenden Zweifel zu finden. Der junge Priester betritt erstmals bewusst die Erde, wird sich des Wertes seines Körpers gewahr und lernt Frauen kennen, die ihn eine ganz andere Welt entdecken lassen. Er kommt zu der Einsicht, dass es nicht gottgewollt sein kann, den Körper, die Welt und die Frauen aus dem Leben eines Priesters auszugrenzen. Gleichzeitig begegnet er den Spuren Luthers. Schicksalhaft kreuzt sein Weg den Alltag zweier deutscher Theologen, die in Rom studieren. Er erkennt die Chance, seinen reifenden Glauben, die theologische Kritik an dem römischen Verständnis von Schrift und Tradition, aber auch sein Leben als Mann stimmig und adäquat in Einklang zu bringen. Der kritische Doktorand nimmt nicht nur die kontroversen Standpunkte unter die Lupe, sondern auch die Frage nach der Bindung an Gott schlechthin. Im Ringen um den rechten, gelebten Glauben zerbröckelt Stück für Stück die Legitimation wesentlicher Lehren und religiöser Bräuche des römischen Systems. Diese Mühe der evangelischen Theologie ist zeitlos und auch heute aktuell. Der Autor bemüht sich um ein gerechtes, ausgewogenes Bild seiner früheren Kirche. Vielfach nimmt er sie in Schutz und beschreibt die liebenswert menschlichen Züge vieler Kleriker und ihre Leistungen, z. B. auf der langen Atlantikreise. Was er ablehnt, ist der römische Zentralismus, die vatikanische Kurie, und die evangeliumsfremden Elemente, die sich in die Kirche eingeschlichen haben.
- Veröffentlicht am Samstag 15. Juni 2024 von Shaker
- ISBN: 9783832215118
- 312 Seiten
- Genre: Autobiographien, Biographien, Philosophie, RELIGION, Sachbücher