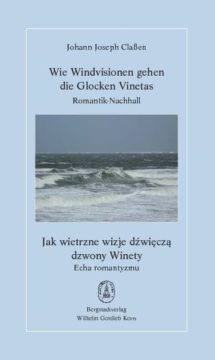Johann Joseph Claßen stellt seinem Lyrikband bewußt den Untertitel „Romantik-Nachhall” voran, weil er damit auf eine Kontinuität in der romantischen Ausdrucksweise der europäischen Dichtung hinweisen will. Auf der Suche nach einer fiktiven blauen Blume durchstreift er unermüdlich das heimische wie fremde Gefilde, allzeit bereit, am frühen Morgen aufzubrechen, um erst zu nächtlicher Stunde irgendwohin zu gelangen,
wo die vermeintliche, in Wirklichkeit nie erreichbare Blume wüchse. Unentwegt versucht er, ihrer vagen Spur überall zu folgen: am Gestade der trauten Ostsee, am Ufer des kühlen, stets böigen Atlantiks, gelegentlich auch an der Küste des lauen Mittelmeeres. Bedenkenlos klettert er bisweilen in die gefährlichen Schluchten des Mittelgebirges, weil er hofft, diese rare Blume gerade in einem schattigen Felsspalt sprießend aufzufinden. Oder wird sie in seiner Gegenwart vielleicht auf einem der Fensterbretter im Klopstockschen Geburtshaus in Quedlinburg aufblühen?
Seine durch äußerst erfinderische Prägung gekennzeichneten Dichtungen nannte Claßen Wie Windvisionen gehen die Glocken Vinetas. Es dürften dieselben Glocken bzw. Stimmen sein, die im ehemaligen Atlantis des Nordens, einer längst untergegangenen Welt des Pruzzenlandes, zu vernehmen waren. Stimmen, die einst meisterhaft Johannes Bobrowski in seinem Zyklus Schattenland Ströme heraufbeschworen hatte, jener in Tilsit gebürtige Wahl-Berliner, der auch den Schlesier Eichendorff unter seiner sensiblen Feder aufleben ließ:
„Eine Zeit der Brunnen / War und der Gärten – der Wald / Ist wie ein Abend gekommen / Vor ihm her ging der Efeu / Die Erde in ihrer Tiefe / Donnert von Strömen …”. (Johannes
Bobrowski, Gedichte, Reclam-Verlag, Leipzig 1990, S. 43)
Genau wie Bobrowski verschrieb sich auch Claßen überwiegend dem eher als frigid empfundenen Norden Europas; zumindest so kann man sein Gemüt und sein ganzes lyrisches Schaffen erleben, die nötige Kraft, um die Klöppel der am Meeresgrund Vinetas ruhenden Glocken in Bewegung zu setzen, so daß sie tsunamiartig die schäumenden Seewogen auftürmen könnten. Dennoch:
Niemand vernimmt sie.
Das Brausen der Brandung
Vergräbt ihr Verwehen.
Kein Wort aus den Wogen –
Vergaß das Vergängnis
Die Stimmen am Grund?
Trotz dieser pessimistischen Ohnmacht, die Claßen verstört, mit den Stimmen Vinetas kommunizieren zu können, bleibt doch ein Trost. Und zwar in der Lehre eines altbewährten Lehrmeisters. Goethe hinterließ nämlich jene überzeitlichen und richtungweisenden Verse, über die man nur schwer etwas mehr hinwegdichten
kann: „Alles Vergängliche / ist nur ein Gleichnis; / das Unzulängliche / hier wird’s Ereignis …” (Chorus Mysticus)
Claßen scheint dieses Goethesche Prinzip irgendwie verinnerlicht zu haben. Daher stellte er sich, dank seiner Begabung und seinem enormen Einfühlungsvermögen, glänzend einer kühnen dichterischen Herausforderung und schuf einen aus zarten Formulierungen zusammengestellten Bilderband voller stimmungsvoller Impressionen, die nahezu alle Sinnesreize eines Lesers bewegen können. Denn seine Gedichte lassen sich nicht nur mit den Augen wahrnehmen, sondern auch mit den Ohren,
mit der Nase und mit der Haut spüren. Dadurch werden sie zu Beweisstücken, wie stark man in eine Landschaft, in ein Gehöft, in ein Kornfeld, in eine Hütte am Waldesrand, in
Spurrinnen im sandigen Dorfweg und, und, und, hineinwachsen kann, so daß man dann selber zu einem Bestandteil dieser Landschaft wird. Peter Handke schrieb einst seine schwärmerisch-schwermütigen Reminiszenzen, die er als Die Lehre der Sainte-Victoire betitelte. Darin setzte er sich, wie jeder Dichter aus Fleisch und Blut, vornehmlich mit sich selbst auseinander. Nicht anders ist es auch bei Claßen. Manchmal könnte man infolgedessen eine scheinbar sinnwidrige Frage stellen: Hat er die Gedichte oder haben die Gedichte ihn erschaffen?
Grzegorz Supady
- Veröffentlicht am Dienstag 10. Mai 2016 von Bergstadtverlag
- ISBN: 9783870573416
- 152 Seiten
- Genre: Belletristik, Lyrik